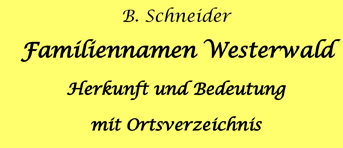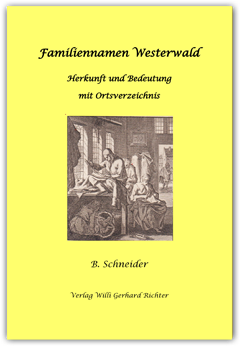Da der Westerwald, auch auf Grund der langen und intensiven Forschung von Barbara Püschel, äußerst gut erschlossen ist, bot es sich an, ein eigenes Buch der Familiennamen des Westerwaldes zu erstellen, da eine Vielzahl der Namen niemals Eingang finden würde in ein allgemeines Buch der Nachnamen für den deutschsprachigen Raum.
Durch die einzigartige Arbeit der Ahnenforscher des Westerwaldes war es auch möglich einige der ersten Namensträger zu dokumentieren und den Ursprungsort der Familie zu benennen.
Vielleicht macht das auch Mut die eigenen Wurzeln zu ergründen, bis hin zum ersten bekannten Namensträger.
Leben im Westerwald im Mittelalter
Es lebte sich schwer im Westerwald. In den Sterbebüchern ist aufgezeichnet, dass die Menschen im Durchschnitt 50 Jahre alt wurden. Geburten waren eine Lebensbedrohung und oftmals starben die Frauen qualvoll im Kindbett, weil es keine Ärzte im Westerwald gab. Deshalb wurde nicht selten dreimal geheiratet. Die Kinder lernten zu Hause, was für das Leben notwendig war. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden die ersten Winterschulen eingerichtet. Nur etwa ein Drittel der Menschen konnte im 19. Jahrhundert lesen und schreiben.
Liebesheiraten gab es in jener Zeit nicht. Die Heirat stand immer unter wirtschaftlichen Erwägungen. Zweckmäßig war eine Heirat des Nachbarn, um einen Vermögenszuwachs zu erreichen. Die Anzahl der Kinder belief sich im Durchschnitt auf acht.
Im Mittelalter waren die Häuser aus Holz, Stroh und Lehm gebaut und sie bestanden aus einem einzigen Stockwerk. Üblicherweise waren der Wohnteil, der Stall und die Scheune in einer Reihe nebeneinander gebaut. An der Wetterseite reichte das Dach des Hauses bis auf den Boden. Betrat man diese einfachen Fachwerkhäuser, kam man zunächst in den Hausflur, der zugleich die Küche war. Im Hausflur oder der Küche befand sich der Kamin mit dem die gute Stube beheizt wurde und wo mit einer schwenkbaren Vorrichtung die Töpfe über die Feuerstelle gebracht wurden. Hier wurde auch geräuchert. Der Wandschrank aus massivem Holz war gleichzeitig der Kühlschrank. Fast jedes Haus hatte ein Spinnrad. Das Bett befand sich oftmals auf dem Boden. Das Kleidungsstück der Männer war das aus blauem Leinen gefertigte „Killche“. Die einfache Feiertagstracht der Frauen war blau-schwarz, ergänzt um ein wollenes Schultertuch gehalten von einer Spange.
Bis ins 18. Jahrhundert aß man mittags Haferbrei. Das Brot wurde aus Korn oder Gerste gebacken und der Kaffee wurde aus Gerste gebrannt.
Die Viehhaltung war bis zum Ende des Mittelalters so geregelt, dass am Rande des Dorfes oder auf den nahegelegenen Höhen Bitzen (Bitze leitet sich ab von „Bizunna“ Einfriedung) angelegt wurden. Oft gingen
aus diesen Bitzen Ortschaften hervor. Die Viehhaltung beschränkte sich auf Schafe, Hühner und Gänse, Rinder gab es kaum und gelegentlich wurden Pferde und Ochsen gehalten.
Die Landwirtschaft bestand seit dem Dreißigjährien Krieg aus der Dreifelderwirtschaft. Auf den drei Feldern wurden der Reihe nach im ersten Jahr Roggen oder Weizen ausgesät, im zweiten Jahr Gerste oder Hafer und das dritte Jahr war das der Brache auf dem das Vieh weidete. Es wechselte also Winterfrucht und Sommerfrucht und die Brache.
Buch-Bestellung
Bestellungen sind ab sofort möglich. Der Versand erfolgt ab 28.10.2024.
Preis 65,00 Euro
Bestellen können Sie über den Verlag Willi G. Richter / WGR-Verlag